Wie Corona die Welt verändert
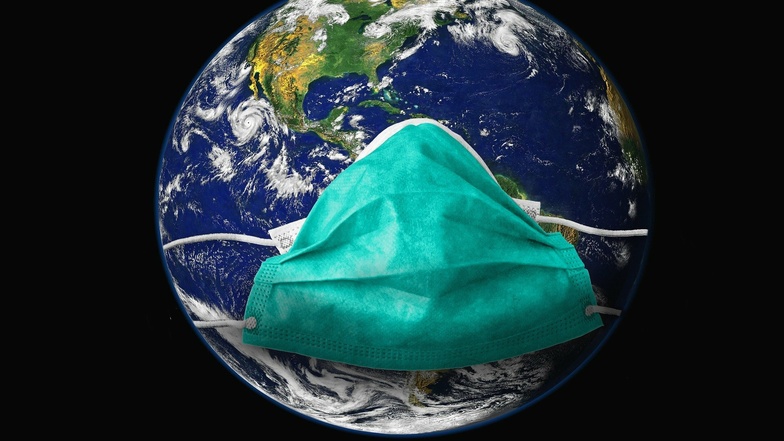
Die Welt hat es kalt erwischt. Vor einem Pandemie-Szenario wie diesem hatten Wissenschaftler weltweit lange Zeit gewarnt. Anfang 2020 war es plötzlich da, real, gefährlich und für viele unglaublich beängstigend. Grenzen wurden geschlossen, Schulen und Kitas machten dicht, Menschen durften sich nicht mehr versammeln – im Großen und auch im Kleinen. Bis in die Familien hinein waren Einschnitte spürbar, wurden von jetzt auf gleich Dinge erforderlich, von denen vorher wohl niemand ahnte, dass sie notwendig werden würden. Was macht solch eine Krise mit den Menschen? Wie verändert sie den Blick auf die Dinge? Vier Wissenschaftler der TU Dresden schauen auf die Folgen der Pandemie.
Studieren zum Nachören: Hier die Corona-Ringvorlesung der TU Dresden.
Professorin Marina Münkler: Eine weltweite Krise wie eine Pandemie beeinflusst nicht nur das Leben vieler Menschen. Sie hat auch Auswirkungen darauf, wie wir über diese prägende Zeit erzählen. Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur, beschäftigt sich schon seit langem mit Erzählmustern. Besonders auffällig sei derzeit, dass Verschwörungsnarrative in vielen Ländern immer mehr Anhänger finden. „Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass es vielen schwerfällt, mit Ungewissheit umzugehen“, sagt die Wissenschaftlerin. Gerade in religiös erkalteten Gesellschaften hätten es Erzählungen über vermeintliche Verschwörungen in solchen Situationen leicht. „Sie erzeugen Selbstgewissheit bei denen, die sie glauben“, ergänzt sie. „Sie haben dann das Gefühl, dass sie die Dinge durchschauen.“ Das bringe unter den Anhängern auch ein Gemeinschaftsgefühl hervor, das aktuell beispielsweise bei den Anti-Corona-Demonstrationen zu sehen sei. Das Problem an Verschwörungsnarrativen sei außerdem, dass sie immer behaupten, es gebe einen Schuldigen. Dabei würden antisemitische Motive teilweise offen zutage treten und neue Virulenz erlangen. „Antijudaistische Narrative haben eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht“, erläutert die Wissenschaftlerin. Die Funktionsmuster solcher Narrative zu erklären, sei deshalb eine zentrale wissenschaftliche Aufgabe. Und natürlich gelte es, solche Narrative mit Fakten zu konfrontieren. Fakten, wie sie Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen liefern können. „Es muss allerdings viel besser kommuniziert werden, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert“, sagt die Professorin. Es könne dabei eben keine hundertprozentige Gewissheit produziert werden. „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vertreten aber auch keine beliebigen Meinungen, sondern argumentieren evidenzbasiert.“ Genau das in die Gesellschaft hineinzutragen, wäre für die Zukunft wichtig. Gemeinsam mit anderen Forschern an der TU Dresden will sie sich deshalb der Thematik widmen. (jam)

Professorin Julia Enxing: Corona hat es bewiesen. Die ursprüngliche Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen macht mehr als deutlich: Wir teilen uns einen Lebensraum. Der wird immer enger. „Die Frage ist, wie wir uns als Menschen zu unserer Umwelt verhalten“, sagt Julia Enxing. Sie ist Professorin für Systematische Theologie am Institut für Katholische Theologie der TU Dresden. „Die Wahrheit ist: Der Unterschied zwischen uns und anderen Lebewesen ist viel kleiner als wir oft meinen.“ In den vergangenen Monaten wurde sie oft mit der Frage konfrontiert, welche Rolle Glauben und Kirche in der Krise spielen. „Ich persönlich hätte mir auf jeden Fall eine klarere Positionierung der Kirche in diesen Zeiten gewünscht“, erklärt sie. Aufgabe der Kirche sei es eben auch, für diejenigen da zu sein, die allein sind oder sich in einer schwierigen Situation befinden. Vor allem während des Lockdowns wäre solch ein Zeichen wichtig gewesen. „Die christliche Botschaft besagt ja, dass wir zuversichtlich sein sollen und dass die Gemeinschaft uns stark macht.“ Gerade die Kirche hätte das viel stärker kommunizieren und mit Leben füllen können. Nicht nur Gläubige hätten sich in der Krise selbst organisiert, viele unterschiedliche Hilfsaktionen wurden gestartet. „Diese große Solidarität hat der Gesellschaft etwas gegeben. Ich hoffe, dass wir aus dieser Erfahrung auch nach der Pandemie schöpfen können.“ Vielen wäre in den vergangenen Monaten deutlich geworden, wofür sie dankbar sind. Der Blick auf das Leben hätte sich verändert. „Wir erkennen es als etwas Zerbrechliches.“ Die Theologin macht sich aber auch Gedanken darüber, was Negatives bleiben könnte. „Zwangsläufig gehen wir jetzt auf Distanz zu unseren Mitmenschen“, sagt sie. „Es wäre schade, wenn dieser Abstand, diese Distanziertheit überdauern.“ Wir sollten andere nicht nur als potenzielle Ansteckungsgefahr wahrnehmen. Die Menschen bräuchten einander. „Wenn sich dieser Gedanke am Ende durchsetzt, wäre das natürlich schön.“ (jam)

Professorin Anna Holzscheiter: Plötzlich diskutiert Deutschland über die Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken oder die personelle Besetzung von Gesundheitsämtern. Die Menschen fragen, warum Pflegekräfte so wenig Geld verdienen und Schulen digital immens schlecht ausgestattet sind. Für Anna Holzscheiter, Professorin für Politikwissenschaft an der TU Dresden, hat die Corona-Krise auch eines gebracht: ein neu erwachtes Interesse der Bürger an Politik, ein wiederentdecktes Gefühl der Teilhabe. „Sicherlich ist diese Pandemie ein Stresstest für unsere Gesellschaft, der auch spalterische Elemente zeigt“, sagt sie mit Blick auf die Corona-Demos. Doch es gäbe eben auch viele, die sich an die Maßnahmen halten und sich zusammen dieser Pandemie stellen. Mit Blick auf Corona-Verläufe in anderen Staaten wäre vielen der Wert einer Demokratie deutlich geworden. Für Anna Holzscheiter kam die Krise nicht überraschend. Durch ihren Schwerpunkt Internationale Politik beschäftigt sie sich schon längere Zeit mit der internationalen Gesundheitspolitik. Eine Pandemie war nur eine Frage der Zeit. Das Reagieren der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei zu Beginn zügig erfolgt, weil sie auf solche Szenarien vorbereitet war. Anders als so manche Staaten. „Einzig eine klarere Positionierung zur Rolle Chinas vonseiten der WHO wäre wünschenswert gewesen“, sagt sie. Die WHO sei aber keine Behörde, sondern eine hochpolitische Organisation. Sie wäre davon abhängig, wie sich ihre Mitglieder verhalten, wie engagiert sie in Sachen Gesundheitspolitik sind. Gerade dahingehend würde sich in Zukunft wohl einiges zum Positiven verändern, hofft die Wissenschaftlerin. Dass sich die USA nun von der WHO abwenden, halten viele für bedenklich. „Ich glaube, wir werden sehen, dass es auch ohne die USA funktioniert.“ Überhaupt würden sich Machtverhältnisse und Bündnisse gerade verändern. Viele Staaten ziehen sich nach innen zurück, was auch durch die Grenzschließungen in der Pandemie unterstützt wird. Gleichzeitig entstehen neue Kooperationen. „Diese Entwicklung gab es schon vor Corona. Aber durch die Krise erhöht sich das Tempo.“ (jam)

Professor Markus Tiedemann: Wer soll gerettet werden – und wer nicht? Was zählt ein Menschenleben? Wie können Gesundheitsschutz, ökonomische Wertschätzung und persönliche Freiheitsrechte gegeneinander abgewogen werden? Fragen wie diese drängten sich auf, als die Welt in den Pandemie-Modus geriet. Markus Tiedemann, Professor für Didaktik der Philosophie und für Ethik an der TU Dresden, sieht ethische Herausforderungen auf mindestens zwei Ebenen. Da sind zum einen Einzelfragen wie die Triage. Als in Oberitalien Beatmungsgeräte in den Kliniken knapp wurden, mussten Ärzte harte Entscheidungen treffen: Wer bekommt die lebensrettende Technik? Triage ist der Fachausdruck für diese Situation, in der das Patientenaufkommen und die vorhandenen Ressourcen eine gestaffelte Auswahl notwendig machen. Eine Einteilung mit oft tödlichen Konsequenzen. „Momentan lassen wir die Mediziner allein mit dieser Frage.“ Die Diskussion, die bereits den Deutschen Ethikrat erreicht habe, müsse zügig in Gesetzgebung überführt werden.Die zweite Ebene ist die der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Folgen die Corona-Krise für die Gesellschaft hat, erklärt Tiedemann. Erneuerung oder Zerstörung, beides sei möglich „Vielleicht beginnt eine Zeit, in der wir uns endgültig in Extremen verlieren, der gesellschaftliche Diskurs sich weiter polarisiert und Demokratie final scheitert. Vielleicht stehen wir aber auch am Beginn einer Restauration, in der wir realisieren, dass Lebensqualität auch ohne exzessiven Verbrauch von Ressourcen möglich ist.“ Zu beobachten sei eine zurückkehrende Wertschätzung für wissenschaftliche Expertise und rationale Entscheidungen. Die Mehrheit der Gesellschaft habe sich bisher sehr rational und klug verhalten. Wer vergleichen würde, wie der Krise an anderen Orten der Welt begegnet wird, könnte dankbar dafür sein, in Deutschland zu leben. „Und dafür, dass wir alle zusammen ein hervorragend funktionierendes Gesundheitssystem finanzieren.“ Für die Zukunft sollten wir aus dieser Pandemie lernen. Die Weltbevölkerung wächst, der Lebensraum wird knapper. „Wir müssen damit rechnen, dass so etwas wieder passiert.“ (jam)

Hier gelangen Sie zur Wissenschaftswelt der Technischen Universität Dresden.
