"Ich kenne auch Phasen mit Hartz IV"

Bernd Wagner stammt aus Wurzen, lebt in Berlin und arbeitet nun ein halbes Jahr lang in Dresden mit einem Stipendium als Stadtschreiber. Er setzte sich gegen mehr als dreißig Mitbewerber durch. Sein Schreiben ist bestimmt von einer kräftigen, bildhaften Sprache, von trockenem Humor und einem Sinn für Details. Mit rund zwanzig Büchern gehört der 71-Jährige zu einer Generation, die Erfahrungen aus Ost und West verbindet. Im Vorjahr erregte er viel Aufsehen mit seinem Familienroman „Die Sintflut in Sachsen“.
Kommen Sie nach Dresden als Liebender oder als Kritiker, Herr Wagner?
Ich komme als Neuling, der einer alten Liebe nachspürt. Als Kind war ich regelmäßig im Sommer hier bei meinem Bruder. Die Sonntagsausflüge mit den Eltern führten in den Süden bis in die Sächsische Schweiz und in den Norden bis zum Wörlitzer Park. Das war das Äußerste. Urlaub haben wir nie gemacht.
Erkennen Sie jetzt etwas wieder?
Wenn ich einen Schaufelraddampfer sehe, fällt mir gleich wieder ein, wie sich mein Vater dort mit einem anderen Passagier um einen Klappstuhl prügelte. Und ich glaube, über den Carolasee im Großen Garten fahren noch dieselben Eisenkähne, in denen ich vor sechzig Jahren saß. Der Anblick der blau gestrichenen Kähne hat mich seltsam berührt. Sie sind älter als ich. So etwas verbindet einen mit dem Leben vorhergehender Generationen. Das halte ich für wichtig, weil der Satz stimmt: Ohne Herkunft keine Zukunft.
Gab es neben der Kindheitserinnerung andere Gründe für Ihre Bewerbung um das Stadtschreiberstipendium?
Allein vom Verkauf meiner Bücher kann ich nicht leben. Wie viele freischaffende Schriftsteller muss ich mich ab und zu nach einem Stipendium umsehen.
Haben Sie konkrete Schreibpläne für Dresden?
Ich arbeite an einer Porträtserie über Schriftsteller, die zwischen 1890 und 1910 geboren sind. Es ist die Generation des 20. Jahrhunderts. Sie haben das Kaiserreich erlebt, den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, und sie dachten nicht nur an ihre literarische Karriere, sondern hatten einen großen Selbstverwirklichungsdrang. Die Namen sind kaum bekannt: Friedrich Sieburg, Ernst von Salomon, Albert Vigolais Thelen, Margret Boveri oder Jürgen von der Wense, der sich im Sommer 1919 in Dresden-Hellerau aufhielt. Es sind die letzten wirklichen Europäer.
Was interessiert Sie an diesen Autoren?
Man versucht ja, Haltepunkte im Leben zu finden, und orientiert sich oft an Menschen mit vergleichbaren Schicksalen. Wie gingen sie um mit Widrigkeiten? Wie setzten sie sich gegen Widerstände in der Öffentlichkeit durch? Ich bin selbst durch verschiedene Gesellschaftsformen gegangen, mir wehte oft der Wind ins Gesicht, und ich musste meine Arbeit verteidigen. Zum Glück fand ich immer wieder Verleger für meine Texte. Doch ich kenne auch Phasen, in denen ich mich bei Hartz IV anstellen musste. Da sind dann Autoren interessant, die keine Kompromisse eingingen und ein respektables Werk schufen.
Ihre Biografie zeigt deutliche Brüche. Sie waren in der DDR Lehrer, dann freischaffender Schriftsteller und haben das Land 1985 verlassen. Hat Ihnen der Vorsprung genützt, als vier Jahre später die Mauer fiel?
Ich bin froh, dass ich meine Erfahrungen allein machen musste und nicht als kollektives Trauma erlebte. Ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren, dass der Westen über mich kam, denn ich hatte ihn bewusst gewählt. Aber natürlich kann ich die Gefühle und Gedanken der Leute im Osten gut verstehen, als plötzlich eine völlig neue Welt über sie hereinbrach.
Wie lässt sich erklären, dass die Nachwehen dieses Prozesses nach 30 Jahren so stark sind?
Ich glaube, die Gründe liegen in den Menschen selbst. Sie hatten in der Wendezeit vielleicht das Gefühl, an den Veränderungen aktiv beteiligt zu sein. Sie hatten die Hoffnung, dass ihr Leben reicher und intensiver würde, vertraten offensiv ihre eigenen Vorstellungen – aber die Gesellschaft ist nie verpflichtet, persönliche Vorstellungen zu befriedigen. Sie geht ihre eigenen Wege. Das kann für den Einzelnen schmerzhaft sein. Es ist ja ohnehin die Frage, inwieweit einer in den historischen Lauf der Dinge eingreifen kann – und inwieweit er ihnen ausgeliefert ist.
Hat es Sie überrascht, dass die Welle der Unzufriedenheit und Aggressivität in den letzten Jahren so hochschlug?
Mich hat es überrascht, wie sich das auf eine Stadt und eine Region konzentrieren kann. Das hängt sicher von konkreten Personen ab, von jenen, die aktiv werden und Demonstrationen veranstalten. Doch es muss auch ein Umfeld geben, in dem eine solche Aktivität fruchtbar wird.
Das hat Sie nicht abgehalten, als Stadtschreiber nach Dresden zu kommen?
Ich habe sicher manches gehört – aber ich möchte es von den Leuten selbst hören und nicht über sie. Insofern bin ich neugierig auf Begegnungen. Es gab immer Zeiten, in denen es nicht einfach war, Stellung zu beziehen – oder einfach in der Stadt zu leben, ohne Stellung zu beziehen. Jede Epoche hat ihre besonderen Zumutungen.
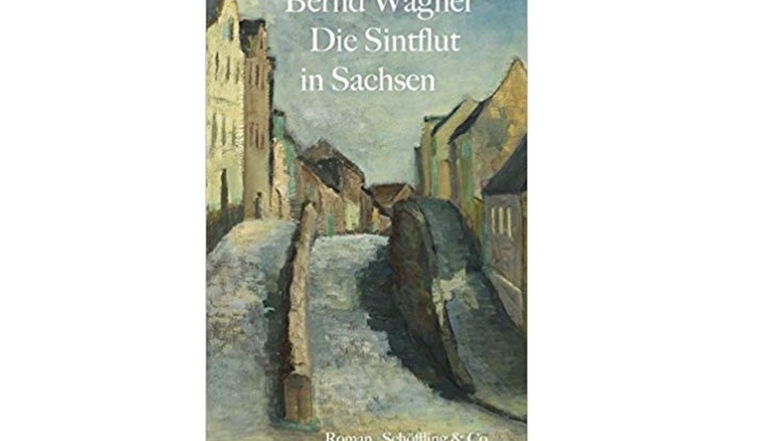
Die Erzählung, mit der Sie sich als Stadtschreiber beworben haben, führt in einem Zeitsprung in den Zweiten Weltkrieg. Anders als im Roman „Die Sintflut in Sachsen“ können Sie dabei nicht auf eigenes Erleben zurückgreifen. Worauf dann?
Als Kind saß ich oft in der Schmiede meines Großvaters auf dem Amboss und hörte zu, was sich die Männer in den Pausen erzählten. Auch am Küchentisch wurde viel erzählt. Ich bin mit Geschichten vom Krieg groß geworden. Und so furchtbar die Zeit gewesen sein mag, so spannend schien sie mir auch. Es gibt einen bemerkenswerten Satz von dem US-amerikanischen Romancier Thomas Pynchon: Jeder hat eine Sehnsucht nach dem Jahrzehnt, in dem er geboren wurde. Für mich sind das die Vierzigerjahre, in die es mich immer wieder zurückzieht wie nach einer Heimat.
Glauben Sie den Geschichten von früher oder halten Sie es mit dem Satz: Misstraut den Zeitzeugen?
Der Begriff ist Quatsch. Wenn ein Mensch Teil eines Ereignisses war, dann war er nicht nur Zeuge, sondern Akteur. Warum sollte man ihn im Nachhinein misstrauisch beäugen und eine eidesstattliche Erklärung über die Wahrheit von ihm verlangen? Nein: Es gibt so viele Geschichtsbilder, wie es Menschen gibt.
Das sagt noch nicht, ob die Bilder falsch sind oder richtig.
Sicher kann man sich im Nachhinein manches zurechtlegen oder sogar glauben, etwas erlebt zu haben, was man aber nur im Fernsehen sah. Ich schreibe mein Leben relativ zügig mit. Ich kann mich selbst befragen, wie es war, und ich kann mich darauf verlassen. Und auf meine Fantasie.
Sie schreiben neuerdings auch Epigramme. Ein Zeichen von Altersweisheit oder von Schreibfaulheit?
Epigramme sind eine leider sehr vernachlässigte Kunstform. Sie kann einen zwingen, in drei, vier Sätzen ein Erlebnis zu komprimieren.
Haben Sie ein Beispiel?
Ich könnte meinen Tagesablauf in Dresden mit einem Epigramm beschreiben: Was Wagner den Tag über tut. Des Morgens schreibt und lieset er, dann geht er aus dem Haus, bewegt die Füße ohn’ Beschwer, trinkt abends eine Flasche aus.
Bernd Wagner hält seine Antrittslesung als Dresdner Stadtschreiber am 27. Juni, 19.30 Uhr, in der Zentralbibliothek im Kulturpalast. Der Eintritt ist frei.

