Ein Dichter muss immer zu weit gehen

Volker Sielaff hat seinen eigenen, ganz besonderen Ton gefunden. Seine Gedichte verbinden Sanftmut und Zorn mit Tiefsinn und Leichtigkeit, Kühnes mit Traditionellem, Welt mit Lausitzer Herkunft. Er stammt aus Großröhrsdorf, ist 54, lebt in Dresden und engagiert sich für ein unkonventionelles literarisches Leben, seit zehn Jahren zum Beispiel für das Festival „Literatur Jetzt!“. Dort findet sich das Alltägliche und das Hochgestimmte ebenso wie in den Titeln seiner Lyrikbände: „Postkarte für Nofretete“ oder jetzt „Barfuß vor Penelope“.
Als Ihr neuer Gedichtband erschien, schlossen die Buchhandlungen. Ihre eigenen Lesungen fielen aus und auch die Lesereihe, die Sie organisieren. Die Herkuleskeule, wo Sie gelegentlich Abenddienst machen, stellte den Betrieb ein. Wie verkraften Sie das?
Ich bin in eine prekäre Situation gekommen. Es ist nicht so, dass ich deshalb in Panik geraten wäre. Ich weiß, dass es anderen ähnlich geht, manchen noch schlechter. Man muss den eigenen Alltag neu sortieren.
Wovon leben Sie?
Von Reserven und vom Kurzarbeitergeld. Da ich nur wenige Stunden in der Herkuleskeule arbeite, ist es eine verschwindend geringe Summe, da liegt man unter Hartz IV.
Als Schriftsteller gehören Sie zu einer Sparte, die ohnehin oft am Existenzminimum lebt.
Die Kunst musste schon immer sehen, wie sie klarkommt. Rainer Maria Rilke zum Beispiel lebte von Mäzenen. Er schrieb seinen Gräfinnen wunderbare Dankesbriefe, die selbst Literatur wurden. Das sollte man nicht geringschätzen. Wer Künstler fördert, schafft vielleicht ein Stück Ewigkeit. Es ist nicht unklug, Kunst den Stellenwert zu geben, den sie verdient. Sie kann unseren Blick verändern, unser Denken, sie kann uns die Schönheit der Welt zeigen und die Tragik der Welt. Viele spüren das, ohne dass es ihnen vielleicht bewusst ist.
Sah es nicht zuletzt so aus, als könnte die Gesellschaft auf Kunst verzichten?
Wenn wir ein rein rationales Leben führen würden, wäre das ein armes Leben. Gerade der erzwungene Verzicht auf Theater, Bibliotheken, Museen, Konzerte hat uns gezeigt, was wir verlieren würden. Es ist ein soziales Experiment, an dem wir gerade teilnehmen, mit offenem Ausgang. Ich möchte nicht zu denen gehören, die jetzt entscheiden müssen. Sie sind oft auch Getriebene. Es ist schwierig, die Gesundheit gegen andere Grundrechte abzuwägen. Das ist ein Konflikt, der eine Debatte braucht. Davon gab es bisher viel zu wenig.
Wie sollte eine öffentliche Debatte stattfinden?
Ich wünschte mir so etwas wie einen großen Runden Tisch, in Berlin oder in den Landesregierungen. Dort müsste sich viel mehr wissenschaftliche Kompetenz aus verschiedensten Richtungen versammeln. Wir kommen nur weiter mit Meinungsstreit. Das ist eine Stärke unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Demokratie, die offenlegen kann und muss, wie sie zu ihren Entscheidungen kommt. Das würde mich interessieren. Da wünschte ich mir mehr Transparenz. Dann wäre die Stimmung vielleicht eine andere als jetzt. Manche Leute haben wirklich Angst. Es war falsch, Angst zu verbreiten.
Hätten Sie sich mehr Eigenverantwortung gewünscht statt Verbote?
Ich hätte mir gewünscht, dass die Maßnahmen gut begründet werden. Ich möchte nicht nur Verordnungen aufgetischt bekommen. Vielleicht hat es auch mit meiner Ost-Sozialisation zu tun, dass ich mich ungern wie in einer Kindergartengruppe behandeln lasse. Das ist mit mir nicht zu machen. Wenn Politiker, die von den Bürgern bezahlt werden, zu diesen sprechen wie Mütter oder Väter, finde ich das unangemessen.
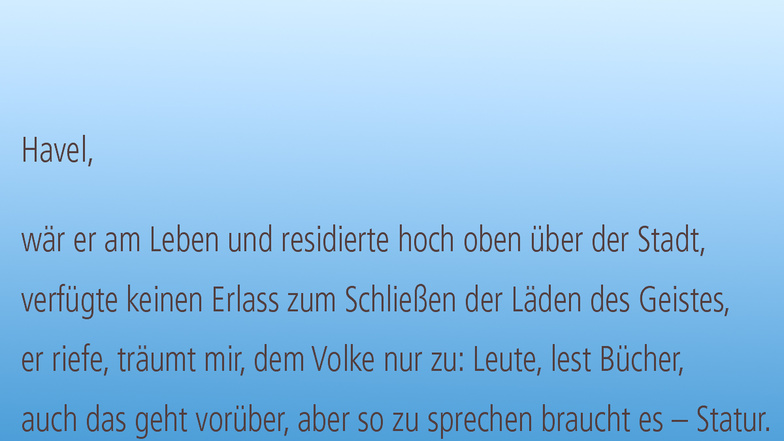
Glauben Sie, dass in der Krise eine Chance steckt und nach Corona vieles besser wird?
Das wäre naiv. Es wird sich nichts Grundsätzliches ändern. Erinnern wir uns, wie viel sich nach der Finanzkrise ändern sollte und wie wenig sich änderte. Die Heuschrecken gibt es immer noch.
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihr Arbeiten aus? Homeoffice ist für einen Schriftsteller ja nichts Neues.
Die Schreibgewohnheiten bleiben. Das tägliche Sitzen am Schreibtisch, das ist wie immer. Aber ich will ja nicht die Luft überm Schreibtisch zu Literatur machen. Ich brauche die Anregungen aus dem Alltag, und der hat sich doch sehr verändert.
Hat Sie das eher inspiriert oder gelähmt?
Am Anfang bin ich zum Nachrichtenjunkie geworden. Ich habe Fakten geradezu aufgesogen, um mir selbst eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist in Krisenzeiten normal. Man gerät in eine innere Stress-Situation. Aber die hält nicht ewig an. Man muss ja weiterarbeiten.
Lassen sich die jüngsten Erfahrungen in Literatur verwandeln?
Ich fürchte, wir werden demnächst überschwemmt von Corona-Romanen, Corona-Lyrik, Corona-Tagebüchern. Ich werde sie wahrscheinlich nicht lesen. Denn Literatur braucht Zeit. Der klassische Wenderoman kam auch nicht schon im Frühjahr 1990 heraus. Bücher, die diesem Etikett nahekommen, erschienen mit zwanzig, dreißig Jahren Verspätung, wie jetzt Lutz Seilers „Stern 111“.
Aber Sie haben in den letzten Wochen geschrieben?
Ich habe gerade das Epigramm für mich entdeckt. Manche halten die Form für antiquiert. Aber man kann damit schnell auf Alltägliches, Politisches reagieren. Ein Epigramm habe ich über die Schließung der Buchläden geschrieben.
Buchläden und Dichter sind nicht systemrelevant. Kränkt Sie das?
Ich halte den Begriff für genauso absurd wie „neue Normalität“. Das sind Suggestivbegriffe, die mehr bemänteln als sie aussagen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich halte jeden Menschen für „systemrelevant“.

Aber es gibt Unterschiede, genauso wie zwischen Ihren Lesern.
Trotzdem will ich sie alle erreichen, meinesgleichen genauso wie die absichtslosen Lyrikliebhaber, die nicht mit einem Fachblick auf die Texte schauen. Als Autor habe ich die Quadratur des Kreises vor.
In Ihrem neuen Buch scheint Ihnen das zu gelingen mit einer hymnischen, überbordenden, aberwitzigen Liebeserklärung an das Leben. Gewinnt dieser Text mit der aktuellen Erfahrung eine andere Bedeutung für Sie?
Ich müsste ihn erst mal wieder lesen dürfen vor Publikum. Aber es stimmt, es ist ein Weltgedicht. Ich glaube, nur die Poesie kann wirklich die Fülle des Lebens zeigen. Denn im Gedicht kommen Dinge zusammen, die scheinbar nicht zusammenpassen. Das Unvereinbare fügt sich dort ineinander, möchte sich umarmen, beißen, anziehen, abstoßen.
Sie erklären Ihre Liebe sogar dem „Klopapier extra weich“.
Es kam schon ins Gedicht, als es noch gar nicht knapp war. Tja, das sind meine hellseherischen Fähigkeiten.
Stimmt es, wenn man Ihnen eine heitere Gelassenheit nachsagt?
Ich sehe mich eher als heiteren Skeptiker. Als Kind war ich schüchtern. Da ist man nicht gelassen. Das habe ich mir erst angeeignet, auch dank guter Freunde. Es ist ja wichtig, wem man im Leben begegnet. Wir brauchen den anderen, der uns prägt, widerspricht, ablehnt, aus all dem setzt sich zusammen, was man Biografie nennt. Drum herum können sich Romane ranken.
Mit einem Roman würden Sie Ihrem Verleger eine Freude machen. Gedichtbände sind meist Zuschussgeschäfte.
Deshalb drängen große Verlage ihre Lyriker zum Roman, aus wirtschaftlichen Gründen ist das verständlich. Ich halte mich auch nicht für ganz unbegabt zur Prosa. Aber ich könnte mich nicht hinsetzen und einen Roman Szene für Szene planen, wie es manche Autoren tun. Dabei würde ich mich zu Tode langweilen.
Sie schreiben über den russischen Dichter Joseph Brodsky, das sei einer gewesen, „der unbeirrt durch die Menge geht und dem Riesen ein Auge aussticht mit einer Feder, die glänzt“. Entspricht das Ihrer Auffassung von Literatur?
Wenn man sich ernsthaft der Poesie widmet, braucht man eine gewisse Unbedingtheit. Man schreibt um alles. Sonst kann man es lassen. Bei Brodsky war das sehr viel ausgeprägter, damit kann ich mich nicht vergleichen. Er hat sich selbst aufs Spiel gesetzt. Er wurde zur Zwangsarbeit verurteilt und später aus der Sowjetunion ausgebürgert.
Sollten Künstler gerade jetzt viel mehr in die Gesellschaft eingreifen?
Wenn ich meine Meinung sage, tue ich das als Bürger, nicht als Autor. Ich mag Künstler nicht, die so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich zweifle lieber. In meinem Buch „Überall Welt“ steht mein Lieblingsausspruch: „Was weiß denn ich!“ Das ist ernst gemeint.
Das Gespräch führte Karin Großmann.

